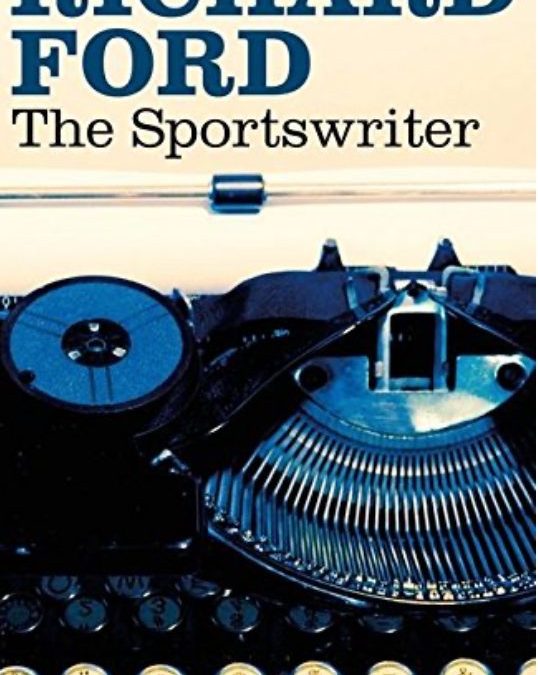Weil mit „Valentinstag“ der nun wirklich (vermutlich) letzte Frank Bascombe Band erschienen ist und das Buch nächste Woche auch in Deutschland erscheint, habe ich nochmals Richard Fords „Sportreporter“ (Link: meine Besprechung auf Buchkarate) gelesen – das allererste Buch über den Normal Man aus New Jersey.
Nie als Reihe geplant ist diese Figur seit 1989 in jedem der alle paar Jahre erscheinenden Bücher einfach so gut geeignet – ist Ford so gut darin – US Amerika durch die Augen dieses Mannes zu zeigen, dass das Nochmallesen nie, nie langweilig ist. Ich bekomme nie genug von diesem ganz besonderen Ton und Blick, der ganz besonderen menschlichen Klugheit und Eigenartigkeit oder dem Humor und den Abgründen, denen man in den Büchern begegnet.
Klar: Das ist Middle Class, White, Privilege Literatur aus Amerika (aka „der Westen“ / das Herz der Finsternis, das Land der Fetten und Irren) – aber es ist eben Literatur. Kein Essay über Das weiße Mittelklasse Amerika der letzten 30 Jahre. Aber so kann man es auch lesen. Dann stößt man sich sicher mehr an Wörtern, Ansichten und gelegentlicher Ignoranz, aber man verpasst dieses allumfassende „Ich weiß doch auch nicht…“ die zarte buddhistische Grundhaltung, die die Bücher durchzieht.
In der Übersetzung von 1989 (und im Original) verstört dabei das N-Wort. Dazu gab es richtigerweise eine Debatte. Und natürlich kommt die Fehde zwischen Ford und Colson Whitehead einem in diesem Zusammenhang auch wieder in den Sinn. Aber klar ist (mir) auch: Das sind die Worte der Figur und nicht des Autors – nur dass wir 35 Jahre nach Erscheinen des Sportreporters heute mit so einer Aussage auch mitten in der Debatte über „Wer darf was über wen sagen, schreiben, filmen?“ angekommen sind. Stichworte: Identität, Privilegien, Sprecherposition, Rassismus, Repräsentation usw.
Auch 1989 war das N-Wort in der Öffentlichkeit benutzt einfach verletzend und rücksichtslos. Heute aber geht die Debatte nicht nur um die angemessene Wortwahl in Gesprächen oder Texten und das Bewusstsein über Rassismus in der Sprache, sondern auch darüber, ob Weiße überhaupt noch über Schwarze (oder Männer über Frauen, oder Hetero- über Homosexuelle usw.) schreiben, sprechen, filmen dürfen. Und ob Kunst Dinge sagen darf, die der gebildete, aufmerksame Mensch nicht mehr so sagen darf.
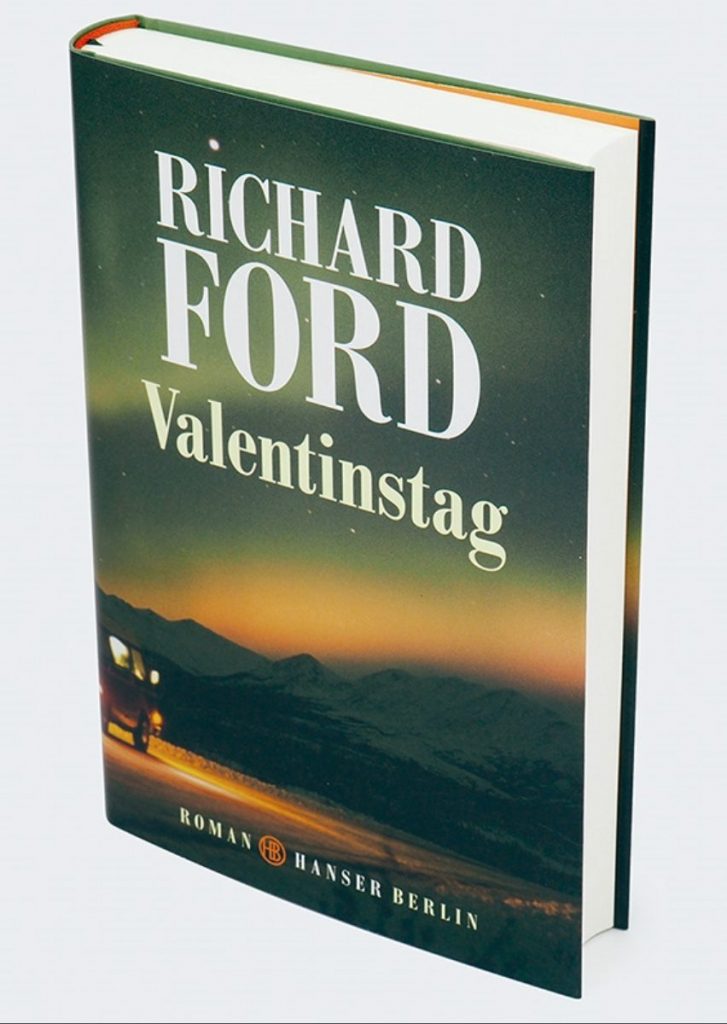 Wir sind heute debattenmäßig weit entfernt vom „Der Autor ist tot!“ der Dekonstruktivisten der 70er, als nur das Werk zählen sollte. Heute wird geschaut, WER über WEN spricht und mit welchem „Recht“ oder aus welcher Perspektive. Und das ist gut. Aber auch gefährlich. Weil Kunst nicht mit Schere im Kopf gemacht werden kann, weil Künstler und Werk (Figuren, Themen..) zwei verknüpfte, teilweise unentwirrbare, aber doch unterschiedliche Dinge sind.
Wir sind heute debattenmäßig weit entfernt vom „Der Autor ist tot!“ der Dekonstruktivisten der 70er, als nur das Werk zählen sollte. Heute wird geschaut, WER über WEN spricht und mit welchem „Recht“ oder aus welcher Perspektive. Und das ist gut. Aber auch gefährlich. Weil Kunst nicht mit Schere im Kopf gemacht werden kann, weil Künstler und Werk (Figuren, Themen..) zwei verknüpfte, teilweise unentwirrbare, aber doch unterschiedliche Dinge sind.
Und weil Kunst nicht die Wirklichkeit ist und nie sein wird. Sie ist Resonanzraum, Spiegel, Hall der Geschichte, Reim auf die Gegenwart oder auch Blick in die Zukunft, aber sicher nicht nur das, was gerade in der Zeitung steht oder worüber an Hochschulen debattiert wird.
Frank Bascombe ist für mich eine Art Fährmann durch die Weite New Jerseys als Symbol für das Leben in den USA im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert. Und viel mehr. Weil ich gerade auch die Springsteen Biografie lese (der daher kommt) und mal wieder Die Sopranos (die da spielen) gucke, ist New Jersey außerdem derzeit ein ganzer Planet unterschiedlicher Perspektiven, sich wandelnder Ansichten und Lebensstile. Sehr amerikanisch, weiß, aber deshalb keineswegs beschränkt. Denn ich bin kein Amerikaner und glaube auch nicht, dass wir dem Land und seinen Menschen „kulturell“ näher sind, als beispielsweise Japan oder Südafrika. Und trotzdem finde ich in den Büchern, in Springsteens Musik oder Tony Soprano etwas über uns, über mich, einen Generation X Typen, deutschen Europäer, Vater, Ehemann, Freund, noch nicht zynisch gewordenen Träumer und weiß der Herr was noch alles. Ich freue ich mich auf das neue Buch, weil es zuerst einmal wieder über das Leben erzählt, wie es eben ist. Oder auch ist zumindest.